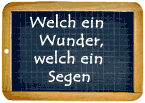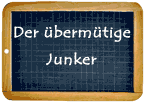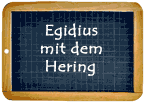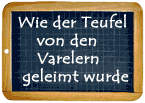Märchen,
Mythen,
Düvelskram
Tafel 3
Welch ein Wunder, welch ein Segen
Vermutlich können sich heute nur wenige Leute vorstellen, dass zu Zeiten der Friesenhäuptlinge mit dem Weihnachtsfest wenig Aufhebens gemacht wurde. Gewiss, Missionare aus Bremen hatten bereits die frohe Botschaft in das Nebel- und Matschland getragen, und in der Christmette trafen sich die bekehrten Anwohner zum Gebet und zur Preisung der heiligen Geburt. Auch hatte der Pfarrer mit seinen Schäflein ein Lied eingeübt. Aus den rauen Fischer- und Torfstecherkehlen klang es allerdings wie eine Schredderanlage zum Zertrümmern von Autowracks. Die Orgelmusik ging in dem Getöse unter. Trotzig hämmerte der Organist mit Fäusten und Holzschlegeln auf die grob gezimmerten Tasten ein, aber genauso gut hätte man eine Herde Ziegen über die Empore treiben können.
Man fror in dem eisigen Kirchengemäuer und wünschte sich die gute alte Zeit zurück. Damals hatte man noch Durchreisenden aufgelauert, die, angesichts der in Aussicht gestellten körperlichen Wohltaten eine saftige Weihnachtsspende in den Klingelbeutel warfen. Oder man legte falsche Leuchtfeuer am Jadebusen, worauf etliche Schiffe strandeten. Das anlandende Treibgut versprach einen geselligen Abend, denn ein Fässchen Schnaps fiel dabei immer ab.
Nach der Christmette also stapften die Vareler schweigend nach Hause, und wenn es hoch kam, holte man aus dem Erker einen Hammelbraten oder einen Salzhering und verspeiste ihn zur Feier des Tages und zur Ehre des aus Bremen herbeigeredeten Gottessohnes.
In der Kammer des Poeten Georg Fuseler ging es nicht anders zu. Er hatte sich eine Milchsuppe aufgewärmt, in die er einige Kanten Brot einstippte. Seine letzte Kerze flackerte und rußte und mühte sich ab, den Anschein von Wärme vorzugaukeln. Es wird Zeit, sagte sich der Heimatdichter, dass das Weihnachtsfest zu dem gemacht wird, was es sein sollte, nämlich zu einem Fest. Was aber ist ein Fest ohne hehre Worte, ohne Reime und Liedstrophen? Ein Abend mit Milchsuppe, nichts weiter. Kein Geringerer als Fuseler war berufen, diesen Missstand zu beheben, und so kramte er seine Schreibfeder hervor und kratzte einen Fünfzeiler auf das Papier:
Glocken klingen zart und helle,
und am Fuß des Weihnachtsbaums
liegt die Gabe wundersam:
Dickmilch in der Suppenkelle!
Lieber hätt' ich Bier statt Rahm.
Nicht schlecht, dachte Fuseler. Nur der Schluss dünkte ihm zu persönlich und nicht feierlich genug. Zudem war ihm durch die Vorfreude auf ein starkes Bier die Niederkunft des Gottessohnes quasi durch die Lappen gegangen. Und wieder kratzte die Feder über das Papier:
Heut' ist uns ein Sohn geboren
unterm kalten Himmelszelt.
Fröstelnd reiben wir die Ohren,
für ein Bier fehlt mir das Geld.
Mist, dachte Fuseler, schon wieder Bier. Ich muss das vermaledeite Wort meiden, dann wird's gehen. Und die Feder kratzte einen dritten Versuch in das Papier:
Welch ein Wunder, welch ein Segen,
es ist uns ein Kind gegeben.
Himmelhoch schallt das Frohlocken,
davon wird die Zunge trocken.
Herr, erhöre mein Gebet:
Schenke mir ein Fässchen Met.
"Jetzt reicht's aber!" rief Fuseler erbost und hämmerte mit der Faust an seinen Schädel. Irgendeine diabolische Macht trieb Schabernack mit seinen Gedanken und mogelte gegen seinen Willen geistige Getränke in seine Gedichte. Wütend warf der Dichter das Tintenfass an die Wand, eine Handlung, die später Martin Luther mit ungleich geringerem Erfolg nachahmte: Denn hier schoss augenblicklich die Zimmerwirtin in die Kammer und verbat sich den Lärm und überhaupt die ganze Sauerei. Martin Luther, pardon, Georg Fuseler wich vor den glühenden Augen der Wirtin zurück, bemerkte eine gelbliche Wolke, die aus ihrem schwarzen Mund waberte, roch Schwefel und Fäulnis - und da fiel der Groschen!
"Du Hexe", japste er, "du warst es, die mir das Bier und den Met in mein festliches Weihnachtsgedicht geschüttet hast. Bestimmt hast du heimlich einen Zaubertrank in meine Milch gemixt, so dass ich blöde und armselig im Geiste geworden bin."
Die unheimliche Wirtin brach in ein Gelächter aus, und dabei entwichen sieben grüne Wölkchen aus ihrem Mund. Auf jedem der Wölkchen saß ein Rabe, und jeder Rabe sah aus wie ein Ferkel. Vielleicht waren es auch Ferkel, die wie Raben aussahen. Jedenfalls hatten die Raben einen Schweineschwanz und die Ferkel einen Rabenschnabel. Hinten grunzte das Rabenferkel, vorne krächzte es. Oben flatterten schwarze Flügel, unten glänzte ein rosa Schweinebauch.
"Selten so gelacht“, schnaubte Fuseler freudlos, "das soll mir wohl imponieren. Tut es aber nicht. Heute ist Heiligabend, und da verfehlt jede Zauberei ihre Wirkung, so auch die auf meine Lachmuskeln."
Die Hexe, denn als solche hatte sie sich zweifelsfrei zu erkennen gegeben, schnipste mit den Fingern. Mit jedem Schnips zerplatzte ein Wölkchen, und die Ferkelraben fielen einer nach dem anderen auf die Dielen. Beim Aufprall verwandelten sie sich in dickbauchige Karaffen, gefüllt mit dem köstlichsten Met. "Schon besser!" rief Fuseler, "jetzt noch eine Flasche Kümmelschnaps, ein saftiges Steak, Kiebitzeier und gebratene Taubenschenkel, und ich will die Störung großzügig vergessen."
Er hatte das letzte Wort noch nicht ausgesprochen, da lag schon alles auf seinem Tisch und dazu noch ein silbernes Besteck. Hungrig stürzte sich der dichtende Habenichts auf das Mahl. Aber soviel er auch aß und trank, die Menge nahm nicht ab, ja, sie schien mit jedem Bissen reichhaltiger zu werden. Umso gieriger und maßloser schlang und schluckte der Poet, und nur einmal – beim Grünkohl mit Pinkel – stockte er kurz, weil ihm ein seltsamer Gedanke zwischen die Zähne gerutscht war. ‚Hier kommt mir irgendwas bekannt vor’, grübelte er, ‚bin ich etwa in einem falschen Märchen gelandet? Gibt es das überhaupt: ein richtiges Märchen im falschen?’ Doch lange hielt er sich nicht mit der Philosophiererei auf und wandte sich wieder dem Fressen und dem Saufen zu. Schließlich gab er auf und sank vollgestopft auf sein Bett. "So kann es jede Weihnacht sein", stöhnte er.
Die Hexe hatte alles schweigend beobachtet. "Hast du nicht etwas vergessen?" fragte sie leise, "vielleicht einen Reim oder ein Gedicht als Dank für die Gaben?"
"Das kannst du haben", prahlte Fuseler, "also höre:
Auf ewig will ich ihm verbunden sein,
der mir gebracht die Gaben.
Zwar fehlte noch ein Stück vom Schwein,
Doch will ich's nicht beklagen.
Meisterlich“, lobte Fuseler sich selbst, „wem darf ich das Gedicht denn widmen?"
Die Hexe wandte sich zur Tür. Im Hinausgehen murmelte sie: "Demjenigen, dem du das Festmahl verdankst. Es ist der Teufel persönlich." Und damit war sie entschwunden. Georg Fuseler aber geistert seitdem als Untoter durch Kaschemmen und Fresspaläste, vornehmlich zur Weihnachtszeit. Wenn ein Gast sein Glas erhebt und einen Trinkspruch ausstößt, ist es niemand anderer als unser armer Dichter, der durch den Schlund des Gastes spricht.